tour 2023/2024
| 19.04.24 |
Göttingen |
Nörgelbuff | ausverkauft |
| 20.04.24 |
Dresden |
Blauer Salon | ausverkauft |
| 27.04.24 |
Münster |
Sputnikhalle (hochverlegt) | ausverkauft |
| 28.04.24 |
Bochum |
Trompete | ausverkauft |
| 03.05.24 |
Meppen |
Jam | ausverkauft |
| 04.05.24 |
Hamburg |
Molotow | ausverkauft |
| 05.05.24 |
Bremen |
Schlachthof (hochverlegt) | Tickets |
| 09.05.24 |
Frankfurt |
Nachtleben | ausverkauft |
| 10.05.24 |
Stuttgart |
Club Cann (hochverlegt) | Tickets |
| 11.05.24 |
Berlin |
Lido (hochverlegt) | Tickets |
| 12.05.24 |
Hannover |
Musikzentrum | Tickets |
| 17.05.24 |
Köln |
Gebäude 9 (hochverlegt) | ausverkauft |
| 18.05.24 |
Saarbrücken |
Studio 30 | Tickets |
| 19.05.24 |
München |
Backstage Club | Tickets |
| 06.09.24 |
Osnabrück |
Haste Open Air | ausverkauft |
| 19.12.24 |
Hamburg |
Knust (Zusatzshow) | Tickets |
| 21.12.24 |
Osnabrück |
Die Botschaft (JAK) | Tickets |
Merch
Findet ihr auf Tour am Merchstand oder bei Uncle M.
oben cloudy Vinyl
jetzt bestellen
Live im Hyde Park Vinyl
jetzt im Bundle bestellen
oben Vinyl
jetzt bestellen
oben CD
jetzt bestellen
Wolke Shirt mit Stick
jetzt bestellen
Lösen Shirt
jetzt bestellen
Halsband Juno GOLD
jetzt bestellen
City-Leine Juno GOLD
jetzt bestellen
oben
eine neue Perspektive
Hi! Spencer, plötzlich leicht wie eine Wolke? Cover und Titel des neuen Albums lassen das vermuten. Aber keine Sorge! „Wir machen immer noch furchtbar melancholische Songs“, sagt die Band, die sich traditionell in keine Schublade stecken lässt, sondern sich irgendwo zwischen Indie, Pop, Rock und Punk befindet. Und doch gibt es in „oben“ einen Twist, der neu ist für die Osnabrücker: Die Songs bleiben inhaltlich nicht da stehen, wo sie beginnen, bohren sich nicht immer tiefer rein in das Gefühl – sondern zeigen Lösungen und Ausblicke auf. Und so schließt „oben“ nahtlos an das letzte Album „memori“ an, denn wie hieß es dort so schön? „Doch das geht, fängt man an, die Perspektive zu drehen.“ Eine andere Sicht einnehmen, eine Situation so annehmen, wie sie ist – das ist ein wesentliches Thema in den neuen Hi! Spencer-Songs.
Das Wechselspiel aus oben sein, oben bleiben und immer mal wieder abzufallen bringt Frontsänger Sven Bensmann gewohnt stimmgewaltig zum Ausdruck. Und das Wissen darum: Es gibt keine pauschal gute Zeit, es gibt nur ein Akzeptieren der Tatsache, dass man irgendwann einen Umgang mit seinen Themen findet. Und sich dadurch oben hält. Nicht die Umstände sind es, die sich ändern – sondern der Blick darauf: „Es tut anders weh, weil ich jetzt versteh …“ („Vermissen“). In „oben“ geht es auch um den Erhalt des Guten und die Gewissheit, dass man immer mal wieder abdriften kann und wird. Und, etwa in Songs wie „Nebel“ oder „Juno“, dass auch andere einen aus einem Tief holen können – und es sich daher immer lohnt, Gutes hochleben zu lassen!
In „Würfel“, der ersten Single der neuen Platte, geht es um monotone Tage, voller Müdigkeit und Unzufriedenheit mit sich selbst. Das zentrale Bild in dem Song ist das Werfen des Würfels – und die damit verbundene komplette Übergabe des eigenen Schicksals an den Zufall. Das Würfelglück soll eben entscheiden, ob heute ein guter oder schlechter Tag werden wird. Dass der Song so passend für die erste Single von “oben” ist, zeigt sich durch den inhaltlichen Relief am Ende des Songs: “Egal ob Würfelglück im Unglück oder andersrum, ich werfe den Würfel weg und geh, denn vielleicht rettest du mich” – zeigt den Entschluss, wieder selbstbestimmt nach Hilfe zu fragen, um oben bleiben zu können.
Passend dazu zeigt das Artwork der Platte erstmalig ein gemeinsames Foto der Fünf. Zentrales Element auf dem Cover ebenso wie bei Merch und Co ist die Wolke – denn kaum etwas ist weiter „oben“. Wolken sind leicht. Sie schweben. Sind hell, oft durchsichtig. Und doch können sie uns die Sicht vernebeln und regenschwer am Himmel hängen. Sie verschwinden, bilden sich neu. Driften ab. Lösen sich auf. Sie können alles sein.
Alles sein – das kann auch die Band Hi! Spencer. Und während ihre Songs teilweise in den Wolken schweben, sind die Fünf selbst mit beiden Beinen fest auf dem Boden geblieben.
„oben“ erscheint am 22.03.2024 auf dem Label Uncle M. Und für alle, die die Platte live hören wollen, schickt zuendstoff Booking Hi! Spencer im Frühjahr und Herbst 2024 deutschlandweit auf Clubtouren und im Sommer auf diverse Festivals – bei hoffentlich wolkenlosem Himmel!
Aufgenommen wurde das Album mit Haus und Hof Produzent Tobi Schneider im DocMaKlang Studio Osnabrück. Für das Mastering wurde Matthias Lohmöller engagiert. Das grafische Konzept und Artwork stammen aus der Feder des Osnabrücker Kreativteams kraem.

hi! spencer
| Jan Niermann Bass, Tasten, Gesang |
Janis Petersmann Gitarre, Gesang |
Sven Bensmann Gesang |
Malte Thiede Gitarre, Gesang |
Niklas Unnerstall Drums |
Me,
Myself
or i?
Die Idee für dieses Projekt entstand nach einem Konzert am Merchstand. Wo uns Menschen erzählen, warum sie auf Konzerte gehen und was Musik ihnen bedeutet. In welchen Songs sie sich selbst besonders wiederfinden – und warum.
Das sind Geschichten des Selbstverlusts und der Selbstfindung, die uns bleibend und immer wieder aufs Neue beindrucken. Erfahrungen, die so bedeutend sind, dass ihnen mehr Raum gebührt. Weil wir glauben, dass man sich selbst auch immer ein bisschen in anderen findet. Und zu wissen, dass man mit einer Sache nicht allein ist, kann helfen, sich besser mit sich selbst zu fühlen.
Manchmal spielt einem das Leben Karten zu, die unfassbar scheiße sind. Und manchmal, wendet sich das Blatt.

Wichtiger Hinweis:
In diesen Texten geht es auch um die Themen Tod, Kindstod, Krankheit, sexueller Missbrauch, toxische Beziehung & Rassismus. Falls diese Themen ungewollte Emotionen oder Erinnerungen in dir hervorrufen, lies diese Geschichten lieber nicht oder nicht allein.
Weitere Informationen und Hilfsangebote zu den speziellen Themen findest du bei den jeweiligen Geschichten.
Diese Plattform bietet Raum für Geschichten des Selbstverlusts & der Selbstfindung. Wenn du deine Geschichte teilen willst, schreib uns gerne.
Dieses Projekt wird unterstützt und gefördert von

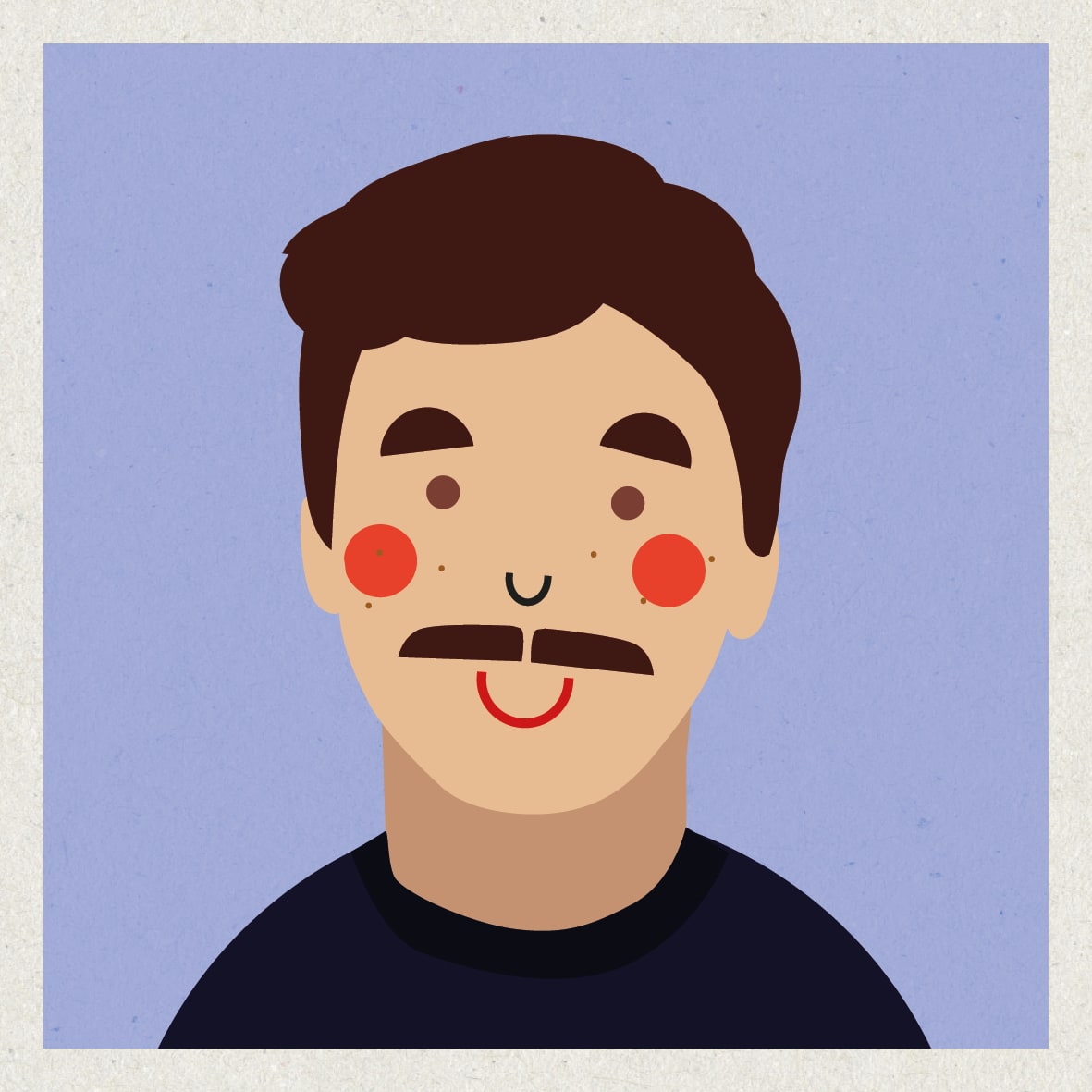
Angelino
Angelino begleitet uns als Band schon ewig. Er war lange Zeit unser Manager, er kennt das Musikbusiness wie seine Westentasche und ist außerdem ein musikalisches Schweizer Taschenmesser – ist irgendjemand von uns einen Auftritt lang verhindert, springt für fast jeden in der Band ein. Auf der letzten Tour bei einem Auftritt in Dresden wurde er mit „Aaaaangelino“-Sprechchören vom Publikum gefeiert, als wäre er Leo Messi und hätte grade einen Hattrick im Classico geschnürt. Und so sehr Leute auf unseren Konzerten Angelino mögen, so sehr mögen wir ihn auch. Story Ende. Story Ende? Nicht ganz, denn: Ach ja, Zusatzinfo: Ange ist schwul. Und das wir diesen Satz schreiben, darum geht’s in dieser Geschichte. Denn Angelino erzählt uns davon, wie es ist, sich outen zu müssen. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder.
Dabei gibt er uns im Gespräch einen Abriss über seine zahlreichen Coming Outs.
Zuerst sein inneres Outing, also die Situationen, mit 9 oder 10 Jahren, in denen er merkt, sich dem Männlichen zugezogen zu fühlen. Dass das anders zu sein scheint, als bei den anderen Jungs, die er kennt. Dass er dadurch wenig Freund*innen hat, weil die Jungs ihn zu mädchenhaft empfinden und die Mädchen ihn nicht mögen, weil er ein Junge war.
Als Angelino mit 13 oder 14 Jahren das erste Mal richtig verliebt ist outet er sich vor seinem Schwarm – seine erstes Coming Out vor einer andere Person. Es entwickelt sich eine kleine Liebesgeschichte. Auch in seinem engsten Freund*innenkreis wissen es nun Menschen, doch als mit 15 der erste Liebeskummer einsetzt, bemerkt seine Mama Angelinos Traurigkeit. Das nächste große Coming Out – eines seiner wichtigsten sagt Angelino – folgt, als er ihr in einem dramatischen Gespräch davon erzählt. Auch wenn in diesem Gespräch viele Tränen fließen, es war der Ausgangspunkt das Thema in immer größeren Kreisen anzusprechen. Erst nur vor den engsten befreundeten Menschen, dann in immer weiteren Kontexten spricht Angelino offen über seine Sexualität. Gleichzeitig versucht er dennoch die Information zu kontrollieren, immer noch Herr der Lage zu bleiben, wer es weiß denn: Ange hat große Angst, dass sein Vater davon erfährt. Aufgrund beiläufige, alltagshomophobe Aussage, die sein Papa in der Vergangenheit bereits tätigte, will er es ausdrücklich vermeiden, dass dieser davon erfährt.
Das führt zu Konflikten. Beispielsweise gibt es große Reibungen in Anges Schule – ein katholisches Gymnasium – dessen Schulleiterin Angelinos offen gelebter Homosexualität missfällt. In einem Elterngespräch outet die Schulleiterin Ange ungefragt vor seiner Mutter (er ist heilfroh, dass sein Vater nicht im Raum ist) und rät ihm an, die Schule zu verlassen. Ein einprägendes und im Nachhinein betrachtet unglaublich diskriminierendes Erlebnis. Doch Anges neue Schule kann besser damit umgehen.
In der nachfolgenden Zeit folgen zahlreiche weitere Outings. In der Schule, im Berufsleben, in privaten Kontexten. Und immer denkt Ange: „Ein großes, so wichtiges Outing fehlt noch, dann bin ich am Ziel. Wenn ich es meinem Vater erzählen kann, dann bin ich durch, mit diesem so anstrengenden Prozess“. Und Ange erzählt ihm davon. Mit 22 Jahren. Eines der schönsten Outings, wie er sagt. Das liegt daran, dass sich sein Vater über die Jahre sehr verändert hat. Die anfängliche Angst, löst sich in einem Happening auf. Damit der letzte Befreiungsschlag. Keine Person mehr, vor der er sich outen will. Er ist durch! Denkt er. Doch er liegt falsch.
An dem Punkt begreift Ange: Er wird niemals damit durch sein, es ist ein Dauerbrenner. In jeder Situation mit neuen Menschen, in alltäglichen Kontakten, wenn er in der Öffentlichkeit mit seinem Freund durch die Straßen geht. Immer wieder aufs Neue sind es Situationen, in denen Menschen kurz komisch gucken. In denen er „der andere“ ist, nicht so wie der Rest der Gesellschaft.
Ange beginnt sich damit auseinander zu setzen, wann er sich bewusst outen möchte und wann ihm das zuwider ist. Und noch heute: In jedem neuen sozialen Kontext in dem er sich begibt, stellt sich für Ange die Frage: Wie offen muss ich mit meiner Sexualität umgehen, wie sehr möchte ich heute wieder „der andere“ sein?
Er stellt die Frage, ob es immer noch gesellschaftlich notwendig ist sich zu outen? Ob es immer noch notwendig ist jedes Mal das innere Empfinden nach außen kehren zu müssen? Und dieses dann immer thematisiert und bewertet wird. Denn Ange sieht auch: Es wird akzeptierter. Die jüngere Gesellschaft wird offener dafür. Die heutigen Kids (Ange ist Mitte 30 und lacht über den Begriff) sind unterstützender, sagt er. Echte Ally sozusagen. In vielen Bubbles ist ein Outing nicht mehr notwendig. Er kommt zum Schluss: Das Ziel soll nicht sein, dass alle sich frei outen können. Das Ziel muss sein, sich nicht mehr outen zu müssen, weil das nicht mehr notwendig ist. Weil alle zusammen anders sein können.
Und bis wir das gesamtgesellschaftlich geschafft haben gibt Angelino den Rat: Du darfst auch ganz aktiv „Nein!“ sagen. Du darfst selbst entscheiden, in welchen Situationen du dich outen möchtest, in welcher Situation deine eigene Sexualität thematisiert werden soll und in welchen Momenten eben nicht. Zum Beispiel, weil du grade kein Lust darauf hast, wieder mal „der andere“ zu sein. Du selbst hast du Zügel dafür in der Hand und sollst darüber entscheiden dürfen.
Sein letztes Coming Out, hatte Ange gestern. Sein neuer Nachbar klingelte und stellte sich vor. Ange erwähnte, im Nebensatz, dass er am Abend noch vor habe, etwas mit seinem Freund zu unternehmen. Eine bewusste Entscheidung, die Zügel selbst in der Hand. Und doch war er wieder kurz „der andere“. Auf der Show in Dresden auf der Bühne letztens, gefeiert wie Messi, da war er einfach nur Ange, so in seiner Ganzheit gesehen wie man nur konnte.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
VLSP*- Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie e.V.:
www.vlsp.de/coming-out
Professionelle Beratungsstellen zum Thema Sexualität und Outing in ganz Deutschland:
www.profamilia.de
Speziell für Jugendliche (Peer Beratung):
comingout.de

Hansol
Hansol ist Sänger und Gitarrist der Band Shoreline, außerdem arbeitet er im Krankenhaus.
Seine Eltern kommen aus Südkorea und sind Anfang der 80er Jahre nach Deutschland eingewandert. Hansol ist in Deutschland geboren und in Südbayern aufgewachsen. Mit 18 ist er fürs Studieren nach Münster gezogen, wo er jetzt seit acht Jahren wohnt.
In Münster ist auch Shoreline entstanden. Eine Emo-Punk Band , die vor Kurzem eine neue Platte veröffentlicht hat, in der es unter anderen auch um politische Themen geht. In einer der ersten Singles „Konichiwa“ thematisiert die Band antiasiatischen Rassismus.
Hansol hat uns von diesen und vielen weiteren Erfahrungen erzählt, die er als POC, also Person of Color, macht und wie es sich für ihn anfühlt in Deutschland zu leben.
Dabei denkt er öfter an Momente aus seiner Kindheit in Südbayern. Im Kindergarten, in der Schule: Häufig gab es hier Situationen, in denen er die einzige nicht weiße Person im Raum war. Er erinnert sich daran, sich als Kind manchmal schlecht gefühlt zu haben wie andere Menschen darauf reagiert haben – heute als Erwachsener versteht er die Zusammenhänge besser. Dieser - oftmals subtile - Rassismus, den er erfahren musste, konnte er als Kind gar nicht so richtig fassen. Heute, mit etwas Abstand kann er diesen besser einordnen.
Neben rassistischen Erfahrungen, die Hansol machen musste, erzählt er uns aber auch eindrücklich von seinem Zwiespalt als Sohn asiatischer Einwanderer*innen. Er hat Korea, das Land aus dem seine Eltern stammen und in dem auch seine Großeltern leben, schon öfter besucht. Er hat dabei eine komische Beziehung zu dem Land, wie er sagt. Er weiß, dass seine Eltern dort herkommen, dass seine Wurzeln dort liegen und eine gewisse Verbindung zu diesem Land in ihm herrscht. Deutlich wird das zum Beispiel am traditionellen Gericht Kimchi, einem scharf eingelegten, intensiv riechendem Chinakohl. Dieses Gericht mag er heute als Erwachsener total gern. Gleichzeitig gibt es eine innere Distanz zu Korea, die schon dadurch besteht, dass er nur bedingt die Sprache spricht. Auch sind ihm manche typisch koreanische Dinge völlig fremd, zum Beispiel sehr differenzierte Höflichkeitsformen oder die sehr konservativ geprägte Kultur, seines in Korea lebenden Teils der Familie.
Hansol merkt, er steht in gewisser Weise zwischen den Stühlen. Aufgewachsen in Deutschland, wo er von Menschen als anders markiert wird und nicht zur vermeintlichen Mehrheit gehört und gleichzeitig verbunden mit Korea, dem Land in dem seine Wurzeln liegen, dass er eigentlich nur aus Familienerzählungen und von Besuchen kennt und dessen Traditionen ihm fremd zu sein scheinen. Er nennt das innere Zerrissenheit.
Doch was hilft Hansol in seiner Zerrissenheit? Zuerst einmal sind da koreanische Serien und Filme. Sie geben ihm ein gutes Gefühl und er bekommt Einblicke in das Land, die Sprache und das Leben der Menschen dort. Durch die Serien kann er sich besser vorstellen, wie sein Leben hätte aussehen können, wäre er in Korea aufgewachsen. Dieses Gedankenspiel ist spannend für ihn.
Und ein weiterer wesentlicher Punkt ist das Sprechen mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, die seine Perspektive kennen. Das ist etwas anderes, als mit Menschen zu sprechen, denen man seine eigene Perspektive erklären muss, ohne ständig das Gefühl zu haben, sich rechtfertigen zu müssen, sagt Hansol.
Und dann ist da noch die Musik. Als Shoreline vor ein paar Jahren gegründet wurde, hätte Hansol sich gewünscht, dass die Promofotos seiner Band ähnlich der anderen Szenebands, aus durchweg weißen Menschen bestehen würde. Dann hätten sie besser reinpasst, sagt er. Heute hat sich etwas in der Szene gedreht. Es scheint: Je diverser die Band ist, desto spannender. Die frühere „Schwäche“ erscheint heute als „Stärke“ und das wird von ihm als angenehm empfunden. Hansol merkt, dass es für ihn die Möglichkeit gibt, Menschen mit seiner Musik zu empowern, die ähnliches fühlen – und bekommt von so vielen Zuschauer*innen die Rückmeldung, dass er das auch tut.
Hansol fühlt sich weder als Deutscher noch als Koreaner, auch wenn er früher immer dachte, dass er eins von beiden sein müsste.
Heute kommt er zum Schluss: Das ist vollkommen egal. Er sitzt zwischen diesen Stühlen. Auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt dort zu sitzen, über die Zeit hat er gelernt, das so zu akzeptieren und sich dort zurechtzufinden. Und am allerbesten ist der Platz, wenn dort ab und an ein Teller Kimchi vor ihm steht.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
VBRG – Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt:
verband-brg.de/beratung
ISD – Initiative Schwarze Menschen in Deutschland:
isdonline.de/ueber-uns

Marie
Marie ist Mitte zwanzig und ein absoluter Hi! Spencer Superfan. Auf der letzten Tour ist sie uns quasi eigenständig hinterhergereist. Sie hat mittlerweile 21 Konzerte von uns besucht – sie führt da Statistik und hat ein eigenes Konzerttagebuch. Ein Platz in der ersten Reihe ist zu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit also von ihr besetzt, egal wo wir spielen. Am Merchstand nach den Shows erzählte sie uns, wie viel ihr die Songs bedeuten, weil sie sie durch eine schwere Zeit begleiten. Unter anderem ist Marie auch ein Grund, weshalb wir dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen haben. Für sie war es wichtig ihre Geschichte erzählen zu können.
Marie berichtet uns von einer zunächst glücklichen Kindheit, die nach Umzug und Mobbing in der Grundschule schließlich durch ein unbegreifliches Erlebnis geprägt wurde. Mit ungefähr 13 Jahren wurde sie von ihrem Bruder vergewaltigt. Sie fühlt sich daraufhin komplett verloren, erzählt einer damaligen Freundin davon, die – ebenfalls überfordert –weder mit der Situation umgehen noch weiterhelfen kann. Marie fragt sich, ob diese Erlebnisse vielleicht normal waren, sie verdrängt sie schließlich und so waren die Erfahrungen sexueller Gewalt über ein paar Jahre nicht mehr präsent in ihrem Kopf. Ihr Gehirn blendete diese unfassbaren Momente aus.
In den folgenden Jahren bekam sie 2-3 Flashbacks, doch erst im jungen Erwachsenenalter kamen die verdrängten Erinnerungen wieder zurück. Sie träumte nachts davon, wachte weinend, schweißgebadet oder schreiend auf. Dies war eine sehr schwierige Phase für Marie, da niemand bis auf ihrem Bruder von den Ereignissen wusste, auch ihre frühere Freundin, der sie sich versucht hatte anzuvertrauen, war nicht mehr präsent. Maries familiäre Situation verschlechterte sich zunehmend. Es kam immer wieder zu Konflikten zwischen ihrer Mutter, sie wurde zum schwarzen Schaf der Familie, wie sie sagt.
Dies führte zu selbstverletzenden Verhalten und erhöhtem Konsum von Alkohol, doch Marie kam zu dem Punkt, dass beide Verhaltensweisen nicht gut für sie sind.
Sie suchte aktiv nach Hilfe und fand diese in einer therapeutischer Behandlung. Die zuständige Psychologin war die erste Person, mit der Marie über die schrecklichen Erfahrungen sprechen konnte. Sie bekam professionelle Unterstützung für die Bearbeitung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung und Depression. Zusammen wurden dabei auch Gespräche mit ihrer Familie vereinbart. Bis heute glauben Maries Eltern ihre Aussagen nicht.
Wenn wir Marie fragen, was ihr bei all dem hilft, erzählt sie davon, dass es wichtig ist, einzusehen professionelle Hilfe zu brauchen und diese auch aktiv einzufordern. Sie sagt, jede und jeder hat ein Recht auf ambulante und stationäre Therapie und Unterstützung. Sie hat sich getraut, diese unfassbar schmerzhaften Erlebnisse dort noch einmal zu thematisieren, aufzuarbeiten und versucht sie zu verarbeiten. Auch wenn das für sie belastend ist, merkt sie: Es hilft ihr und deshalb bleibt sie dort am Ball.
Innerhalb dieses professionellen Netzwerks baut sie grade Perspektiven für sich auf. Sie findet dort Halt und macht die Erfahrungen, dass sie nicht fallen gelassen wird. Gemeinsam arbeiten sie zur Zeit an einer Zukunft, in der sich Marie gut fühlt. Sie hat dort auch viel darüber gelernt, Phasen der Depression frühzeitig zu erkennen und Möglichkeiten gefunden, die ihr im Umgang damit helfen und ihr gut tun.
In Maries Fall ist das vor allem die Musik. Die Songs „ihrer Bands“ wie sie sagt, sind für sie Rettungsanker und in akuten Phasen schnappt sie sich eben ihre Kopfhörer. Doch besonders Konzerte sind für sie ein Schnellladekabel für ihre psychische Gesundheit. Sie beschreibt das Bild einer Klippe an dessen Rand sie permanent entlangläuft und droht hinabzufallen. Konzerte ziehen sie dabei regelmäßig wieder auf die sichere Seite. Deshalb nutzt sie jede erdenkliche Möglichkeit diese Bands auch live zu sehen. Aber es ist nicht allein die Musik. Auf den Shows trifft sie andere Fans, die sie dort kennengelernt hat, die zu Freund*innen wurden und die gänzlich verschiedene, aber ebenso bewegende Geschichten erlebt haben und mit denen sie über ihre Erlebnisse sprechen kann.
Die ihr zuhören, ihr glauben und sie schätzen. Und die ihr zwischen den Songs dann zurufen: „Marie, es ist schön, dich so glücklich zu sehen“.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch:
www.hilfe-portal-missbrauch.de
Weißer Ring:
www.weisser-ring.de

Leonie
Leonie (den Namen haben wir auf Wunsch der Person geändert) ist eine der absoluten Superfans unserer Band. Es gibt kaum Shows, die sie von uns verpasst. Sie ist Teil eines kleinen Hi! Spencer-Fanclubs, also Freund*innen, die sich auf unseren Konzerten kennengelernt haben und die Shows seitdem gemeinsam ansehen. Sie organisiert Konzertkarten für die Leute aus der Gruppe und lässt sie auf ihrem Sofa schlafen. Leonie sagt, sie kümmert sich gern um andere. Und da setzt sie auch ihre Geschichte an.
Schon in ihrer Schulzeit hat Leonie gemerkt, dass sie gern Menschen hilft und Bestätigung darin findet. Sie war die Ansprechpartnerin schlecht hin, wenn ihre Freund*innen ein offenes Ohr brauchten, fand sich fast immer in der Rolle als „Gruppenmami“ wieder und stand Menschen bei Problemen mit Rat und Tat zu Seite.
Für Leonie war das immer ein Selbstbewusstseins-Push, sagt sie. Ihren Selbstwert konnte sie vor allem dann steigern, wenn andere Menschen sie brauchten. Leonies eigene Gefühle, ihre eigenen Probleme konnten so für sie gut ausgeblendet werden. Was sie selber ausmachte und wer sie darüber hinaus war, das stand nie im Mittelpunkt.
Irgendwann ist Leonie dann aber in eine toxische Beziehung geraten. Keinem der Beiden war zu Beginn bewusst, dass er unter einer starken Depression litt und er war noch nicht an dem Punkt sich professionelle Unterstützung einholen zu wollen. In seinem sozialen Umfeld wurde sie schnell nahezu seine einzige Ansprechpartnerin und Bezugsperson. War das in der rosaroten Phase ihrer Beziehung noch schön, forderte Leonies Freund die gemeinsame Zeit im Laufe der Beziehung stärker ein. Er wollte sie nahe zu rund um die Uhr um sich herumhaben. Ein emotionaler Druck wurde aufgebaut, ihr Freund wollte Regeln aufstellen, wie oft und lange Leonie bei ihm sein sollte, damit er sich glücklich in der Beziehung fühlte. Leonie vermisste es Zeit mit ihren Freund*innen verbringen zu können. Als sie das äußerte, wurde ihr Egoismus von ihm vorgeworfen. Für Leonie, eine Person, die sich lange Zeit schon über das Helfen von anderen definierte, eine schwer treffende Beleidigung.
An einem Abend spitzte sich die Situation dann zu. Die Beiden waren auf einer Party eingeladen. Leonie kommunizierte im Vorfeld, dass dabei Situationen entstehen könnten, in denen sie mit Freund*innen sprechen und ihn für eine gewisse Zeit allein lassen müsse. Als sie nach einem längeren Gespräch zum Tisch ihres Freundes zurückkehrte, war dieser angetrunken, außer sich und beschimpfte sie, ihn im Stich gelassen zu haben. Leonie wollte die Situation verlassen, wurde am Arm festgehalten und konnte mit Hilfe anderer Menschen den Raum verlassen. Sie konnte bei Ihrem besten Freund übernachten. Am nächsten Morgen schickte ihr Freund ihr eine zutiefst beleidigend formulierte Nachricht, in der sie beschuldigt wurde, fremdgegangen zu sein.
Ab diesem Zeitpunkt wurde Leonie langsam bewusst, die Beziehung beenden zu müssen. Die Beiden legen zunächst eine Beziehungspause ein. In diesem Sommer besuchte Leonie Festivals, verbrachte Zeit mit ihren Freund*innen und stellte fest: Sie wird zum ersten Mal eine Person fallen lassen müssen, sie wird jemandem nicht helfen können. Sie merkte gleichzeitig, dass ihr es guttut, ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und sich kurzzeitig selbst in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.
Sie beschloss sich endgültig von ihm zu trennen. Bei dem Trennungsversuch wirkte ihr Freund extrem angsteinflößend, starrte während des Gesprächs auf einen Messerblock, sperrte sich im Nachgang des Gesprächs ins Badezimmer ein und versuchte sich selbst zu verletzen. Leonie musste diese Situation gänzlich allein aushalten. Aus Angst und weil Ihr die Person an sich dennoch wichtig war, bleibt sie in der Beziehung, benennt aber, dass sie in der kommenden Woche im Urlaub und nicht oder nur schlecht erreichbar sein werde. Dort angekommen schickt ihr Freund Nachrichten, die Leonie das Gefühl vermitteln, er wolle sich umbringen. Aufgrund der räumlichen Distanz ruft sie die Polizei, mit der Bitte nach ihm zu sehen. Leonies Freund wollte sich jedoch nicht umbringen, sagte die Polizei, es folgten nur noch mehr Nachrichten mit Beschuldigungen von ihm.
Ab diesem Zeitpunkt schafft Leonie es, die Nachrichten und Anrufe ihres Freundes zu ignorieren. Irgendwann steht ein Paket mit privaten Dingen vor ihrer Tür, die noch in der Wohnung ihres Freundes waren. Die Beziehung ist endgültig vorbei.
Rückblickend war Leonie durchgängig bewusst, dass das Verhalten Ihres Freundes nicht böswillig gemeint war. Aus ihrer Sicht war es ein Bedürfnis nach umfassender Unterstützung und Hilfe. Ihr wurde jedoch klar, dass ihr Freund mehr Hilfe benötigen würde, als sie geben könnte. Im Nachhinein stellt Leonie fest, dass es das erste Mal in ihrem Leben war, dass ihre bedingungslose Unterstützung für andere Menschen nicht dazu führte, ihr etwas zu geben – vielmehr raubte es ihr Kraft.
So zehrend die Beziehung war, sie half ihr für die Zukunft in sich hinein zu hören und darauf zu achten, wie es ihr gerade geht, um dort auch Zweifel und Ängste ganz bewusst zulassen zu dürfen.
Und bei all dem unterstützt sie dabei heute ihr wundervoller neuer Freund. Über den sie sagt, dass sie ab und an Tränen in den Augen hat, weil sie so stolz ist, ihn zu haben. Und bei dem sie häufiger mehr nehmen kann, als sie gibt.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
Deutschlandweite professionelle Beratungsstellen zum Thema Beziehung und Partnerschaft:
www.profamilia.de/themen/eltern-sein/partnerschaft
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen:
www.bafza.de/rat-und-hilfe/hilfetelefon-gewalt-gegen-frauen
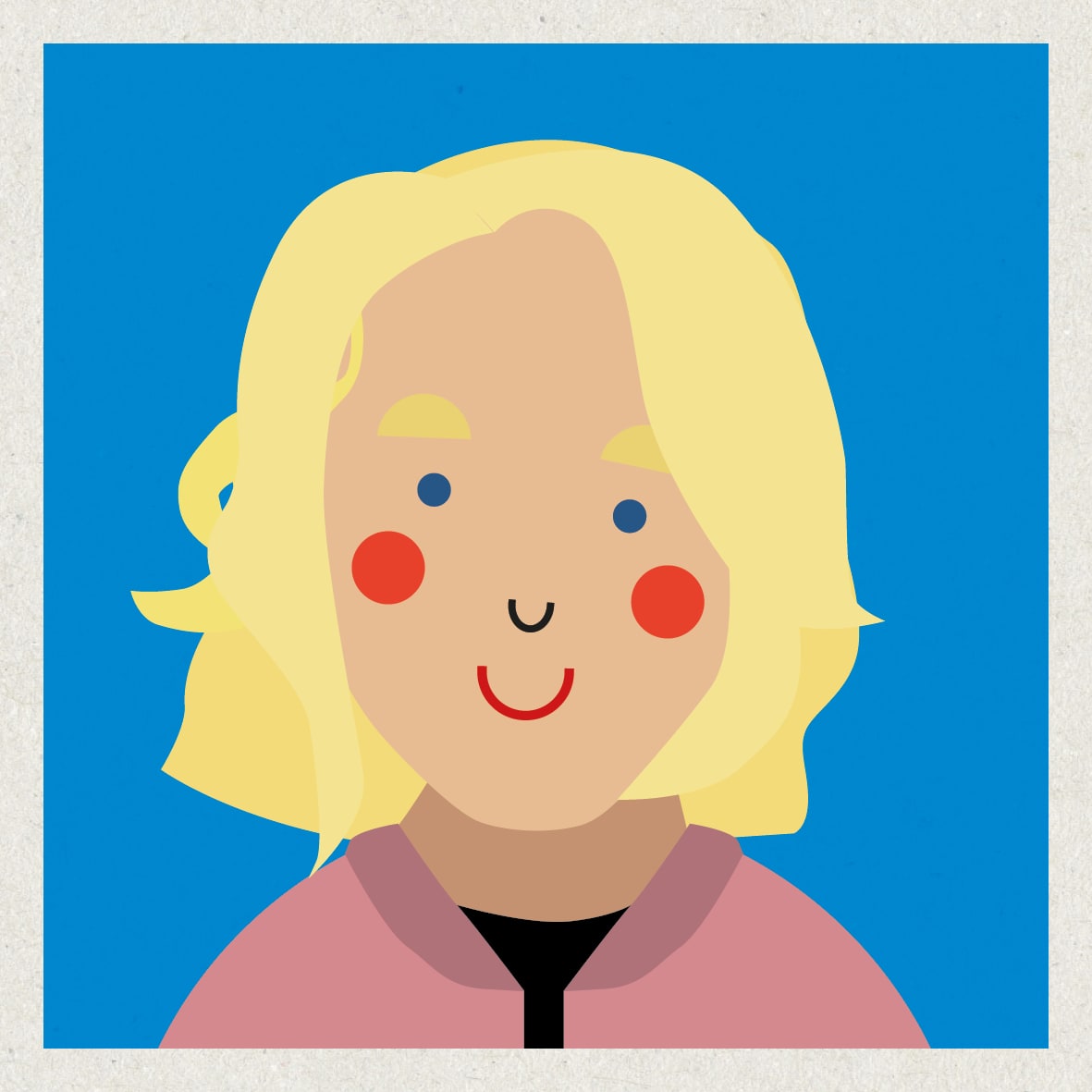
Nadine
Nadine liebt den Norden und lebt in Hamburg. Seit 12 Jahren hat sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die in Fachkreisen „Colitis ulcerosa“ genannt wird. Nadine also hat einen entzündeten Enddarm. Die körperlichen Folgen der Krankheit sind unter anderem blutige Durchfälle und Erbrechen. Dadurch, dass sie über längere Zeiträume kaum essen kann, fühlt sich Nadine oft erschöpft und hat mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen.
Nadine redet offen über Exkremente. Sie findet, dass solche Themen enttabuisiert werden sollten – und im Gespräch mit ihr merkt man: Sie ist Expertin ihrer Krankheit, erklärt fachfrauisch medizinische Begriffe, es gibt kaum etwas, dass sie nicht über das Thema weiß. Das liegt vor allem daran, dass zu Beginn ihrer Symptome viele Ärzt*innen nicht wussten, worum genau es sich da handelt. Sie bekam wenig Aufklärung und damit auch wenig Hilfe. Vor ungefähr fünf Jahren bekam Nadine dann die Diagnose der „Colitis ulcerosa“. Sie erlebte bereits vier starke Schübe, also Phasen innerhalb der die Krankheit besonders heftig auftritt. Der letzte Schub begann vor zwei Jahren. Nadine verbrachte 2020 insgesamt knapp fünf Monate im Krankenhaus, kaum Medikamente haben angeschlagen und sie musste künstlich ernährt werden.
Neben den körperlichen Belastungen, die die Krankheit mit sich bringt, kämpft Nadine mit Krankenkassen und Papierkram, um Erwerbsminderungsrenten oder ihren Status der Behinderung durchzuboxen. Zur physischen Belastung kommen manchmal Verlust-, Zukunfts- und Existenzängste.
Einen großen Teil ihrer Erzählung widmet Nadine jedoch dem Einfluss, den die Krankheit auf ihre zwischenmenschlichen Kontakte nimmt. Durch die „Colitis ulcerosa“ und die damit verbundene schwankende Tagesverfassung, gehören Absagen in der Planung ihres Alltags zur Normalität. Die erschwerte Nahrungsaufnahme ist dazu sehr kräftezehrend, sodass Nadine ihre Kapazitäten für den Tag gut aufteilen muss. Das führt dazu, dass manche Kontakte nicht so gut gehalten werden konnten. Gleichzeitig waren viele ihrer Freund*innen mit sich selbst beschäftigt und haben nicht mitbekommen, dass es ihr schlecht ging. Viele frühere Bekannte meldeten sich kaum noch. Freund*innenkreise führten Aktivitäten ohne sie durch, es kam zu Beziehungsabbrüchen. Nadine ist ihren ehemaligen Freund*innen nicht böse darum, denn sie weiß, dass die Auseinandersetzung mit Krankheit auch für das soziale Umfeld schwer sein kann, doch hat sie sich entschlossen, Abstand von Menschen zu nehmen, die sie nicht unterstützen können. Und bei Nadine bedeutet dies bedingungslose Unterstützung, wie sie betont.
Diese bedingungslose Unterstützung kann ihr zur Zeit keine andere Person geben. Die Trennung ihrer letzten Partnerschaft – die große Liebe, wie sie sagt – führt Nadine auf die Krankheit zurück. Die Belastung war auch für ihren Partner zu groß. Auch wenn sie ein funktionierendes soziales Umfeld und eine Familie besitzt, wenn es hart auf hart kommt, fühlt sich Nadine gänzlich auf sich allein gestellt.
Was aber ganz deutlich wird: Nadine verliert sich nicht in diesem allein sein. Vielmehr erzählt sie, dass sie durch diese Erfahrungen gespürt hat, sich bedingungslos auf sich selbst verlassen zu können. Sie hat für sich festgestellt stark und unheimlich belastbar zu sein und sich immer wieder selbst auf die Beine stellen zu können und darauf ist Nadine stolz.
Sie ist stolz darauf, dass sie nicht aufgegeben hat, sich den Darm nicht hat rausnehmen lassen, um ihn gegen einen künstlichen Ausgang zu tauschen. Dass sie neue Behandlungen gestartet hat und zur Zeit medikamentös eingestellt ist, dass es ihr damit gut geht. Dass sie ihre Erwerbsminderungsrente beantragt und wieder angefangen konnte zu arbeiten.
Und so sehr sie die Erfahrung gemacht hat, all das in letzter Konsequenz immer mit sich selbst ausmachen zu müssen und auch zu schaffen, will Nadine andere Menschen mit ähnlichen Erfahrungen unterstützen und informieren. Sie schreibt deshalb auf ihrem Blog „Pommes und Wahnsinn“, ist Patientenbotschafterin und engagiert sich für Enttabuisierung von Darmkrankheiten überall wo es nur geht.
Sie will bedingungslos unterstützen. Denn für sie ist wichtig, dass andere Menschen erstmal nicht allein sind, um am Ende dann gut mich sich allein sein zu können.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
Nadines Blog „Zwischen Pommes und Wahnsinn“:
www.instagram.com/zwischen_pommes_und_wahnsinn/?hl=de
Chronisch glücklich e.V.:
www.instagram.com/chronisch_gluecklich/?hl=de
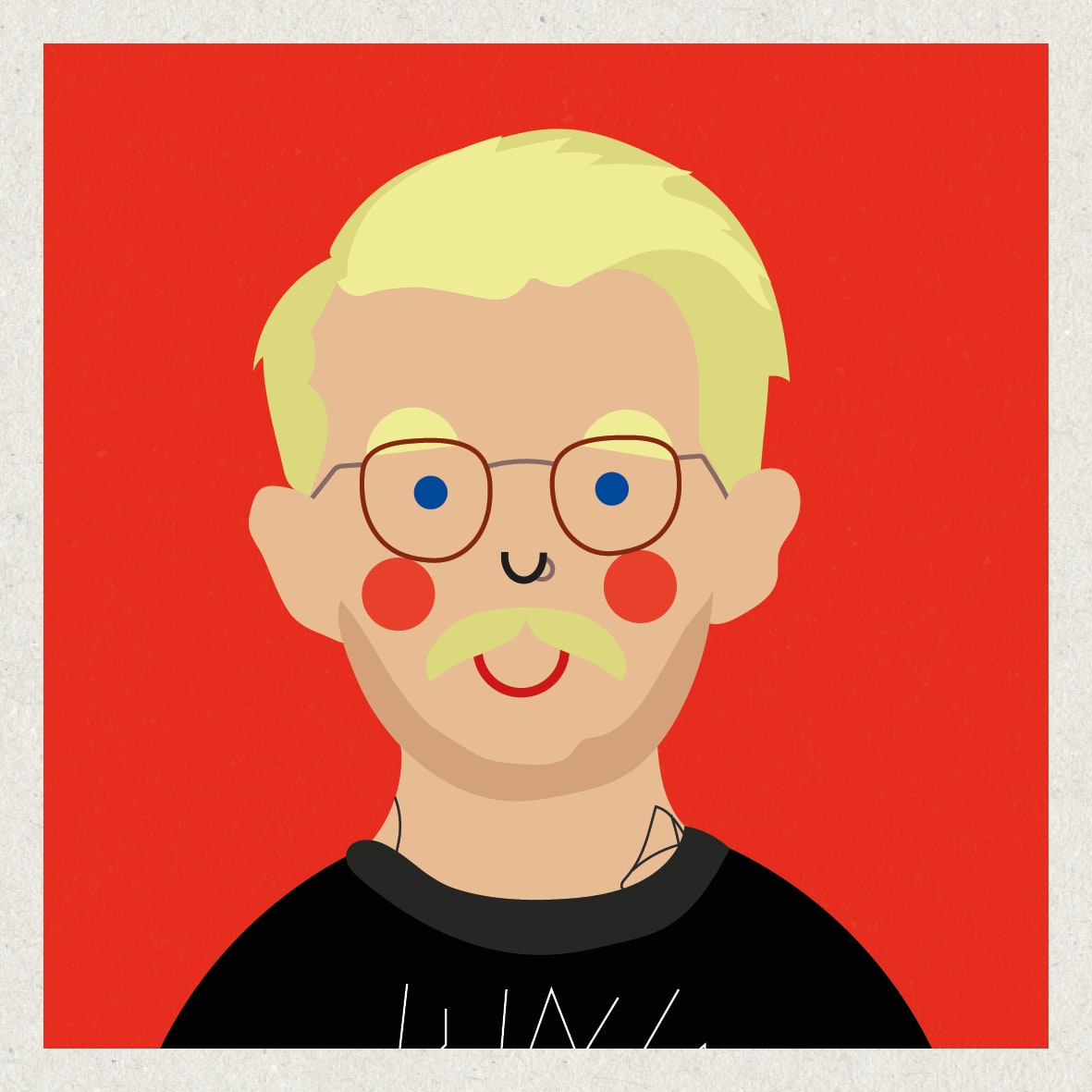
Nicholas
Nicholas ist Sänger der Band Jupiter Jones. Und er hat ein Buch geschrieben. Einen Bestseller sogar. „Ich bin mal eben wieder tot“ heißt es – und Nicholas erzählt darin, wie er lernte mit seiner Angst zu leben. Als Nicholas 24 ist und seine Mama und seine Oma, die ihm beide wahnsinnig am Herzen liegen, kurz nacheinander sterben, erlebt er so eine Panikattacke zum ersten Mal. Der Herzschlag beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, der Atmen wird schneller, Schweiß bricht aus. Ein Herzinfarkt? Ein Schlaganfall? Ein Tumor? Nicholas kann die Symptome nicht deuten, als sie zum ersten Mal auftreten. Nach vielen medizinischen Untersuchungen dann die Diagnose: generalisierte Angststörung mit starken Panikattacken, Hypochondrie und depressive Episoden.
Zehn Jahre lang lebt er mit der Krankheit. Sie begleitet seinen Alltag. In stinknormalen Situationen, beispielweise wenn er auf dem Sofa liegt, überfällt ihn diese Angst. Ein Gefühl, als klopfe der Tod an die Tür. Alle Sinne werden scharfgeschaltet, als würde er einem Säbelzahntiger gegenüberstehen. Das fühlt sich total überfordernd an – und ist ebenso unnötig, weil er diese intensive Wahrnehmung in solchen Momenten für nichts verwenden kann. Solche Panikattacken passieren täglich, mindestens einmal. Er bekommt Angst vor der Angst, die ihn immer übermannen kann. In den ungünstigsten und unnötigsten Situationen sucht sich die Angst ihre Räume – Nicholas nennt sie deshalb auch eine „ganz perfide Pottsau“– denn manchmal hindert sie ihn daran, selbst die alltäglichsten Dinge zu tun, wie in den Supermarkt zu gehen.
Zehn Jahre lebt er mit der Krankheit bis gar nichts mehr geht. Sein Song „Still“ ist zu diesem Zeitpunkt das meistgespielte Lied im Radio. Da begibt er sich in Therapie, zieht sich aus allem raus und verlässt auch die Band. 10 Wochen geht er in eine Klinik für Psychosomatik und lernt dort mit seiner Angst zu leben. Vor allem, ihr Raum zu lassen. Als Panikpatient*in, so sagt Nicholas, tendiert man immer dazu, die Angst soweit es geht zu ignorieren, sie nicht da haben zu wollen. In der Klinik wurde dieser Spieß umgedreht. Er sollte die Momente anerkennen, die Angst zulassen und dabei immer wieder merken: Die Angst bringt ihn nicht um und er kann sie kontrollieren. Nicholas erklärt das mit dem Bild eines ungeliebten Bekannten – Onkel Jürgen, der einfach ungefragt vorbeikommt und nicht mal anklopft. Der Trick ist, sagt Nicholas, Onkel Jürgen jetzt nicht anzuschreien oder zu provozieren, sondern kurz Platz nehmen zu lassen. Soll er die ollen Kamellen von früher ruhig erzählen – danach kann er ihn dann langsam, aber sicher wieder heraus komplementieren.
Angst, so stellt Nicholas fest, ist dabei aber auch immer nur ein Symptom, ein Hinweis des eigenen Körpers, dass irgendwas in Unwucht geraten ist. Dass eine Acht im Rad ist, sozusagen. Als er herausgefunden hat, wo seine Dellen gesessen haben, konnte er diese Dinge angehen und damit auch die Angst an sich.
Auch wenn er selbst mit Lanz und Hallaschka über das Thema gesprochen hat, ist ihm wichtig: Man muss als Angstpatient*in nicht mit jedem Hans und Franz über die eigenen Erfahrungen sprechen, wenn man das nicht möchte. Nur mit Scham solle man der Krankheit nicht begegnen. Denn sie ist weiter verbreitet als man denkt: 25 % aller Menschen erleben mindestens einmal im Leben eine Angststörung.
„Sei dir wichtig genug, um dich um dich selbst zu kümmern“, sagt er. „Und damit auch um die Menschen, die die Krankheit mit dir leben. Such dir eine Therapie. Lass dir helfen. Denn: Du bist nicht mutig, nur weil du keine Angst hast.“
Nicholas ist heute ein um 800 % glücklicherer Mensch als vorher, auch wenn ihn die Angst nicht verlassen hat. Das wäre auch weder möglich, noch so richtig gut, hält er fest – schließlich ist Angst ein Urinstinkt, der vor Gefahren schützt. Es ist nur wichtig, zu merken, dass es kein Säbelzahntiger ist, der vor der Tür lauert, sondern bloß Onkel Jürgen.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
Nicholas Buch:
www.droemer-knaur.de/buch/nicholas-mueller-ich-bin-mal-eben-wieder-tot-9783426789186
DASH-Deutsche Angstselbsthilfe:
www.angstselbsthilfe.de/dash
MASH-Münchener Angstselbsthilfe:
www.angstselbsthilfe-muenchen.de

Stefan
Stefan ist Musiker unter dem Künstlernamen „Das Ding ausm Sumpf“. Er hat Operngesang studiert, in VWL promoviert, arbeitet als Aufsichtsrat und Unternehmer und rappt über „die Sinnlosigkeit einer kapitalgedeckten Welt“ (Reeperbahnfestival 2019). Allein letztes Jahr live über 40 mal in ganz Deutschland zu sehen, u.a. mit das Lumpenpack und Großstadtgeflüster. Das klingt wahnsinnig aufregend, phantastisch und unheimlich interessant und allein das würde schon Stoff bieten, hier Seiten an Texten zu füllen. Die Geschichte, an der uns Stefan hat Teil nehmen lassen, ist allerdings brutal schmerzhaft.
Vor rund zwei Jahren werden Stefan und seine Frau schwanger. Zum zweiten Mal soll es Nachwuchs geben, sogar Zwillinge. Doch innerhalb der Schwangerschaft kommt es zu riesigen Komplikationen. Es ist nicht klar, ob die beiden Jungen – sie werden Sirius und Atreju heißen – es überhaupt auf die Welt schaffen und wenn, ob sie gesund sein werden und ob seine Frau die Schwangerschaft überhaupt austragen kann, ohne ihr eigenes Leben zu riskieren. Stefan und seine Frau sprechen in dieser Zeit mit unzähligen Ärzt*innen, suchen sich die besten Expert*innen innerhalb des Gebietes, beziehen ihre Familie ein und wägen ab. Es ist eine Zeit, die von Diskussionen, dem Für und Wider geprägt ist, von Hoffen und Zweifeln. Ein statistischer Einzelfall, in seiner ganzen Brutalität.
Als sich der Gesundheitszustand von Stefans Frau stark verschlechtert wird die Entscheidung getroffen, dass die Zwillinge zu einem Zeitpunkt auf die Welt geholt werden müssen, an dem klar ist, dass Sirius und Atreju die Geburt nicht überleben werden. Die beiden Kinder sterben in den Armen ihrer Eltern. Sie sind gekommen, um zu gehen, sagt Stefan.
Und Stefan erzählt weiter… vom schlagenden Herzen Atrejus, von der Stille danach und der Angst, dass alles so schnell ging, zu schnell ging und sie eigentlich doch nicht existiert haben.
Er beschreibt aber auch den Umgang mit diesem so brutalen Erlebnis und den Prozess, der darauffolgte. Eine Reise, die Stefans Weltbild neu justierte. Was früher wichtig war, war plötzlich nebensächlich. Was früher riesige Schatten für Stefan waren, waren plötzlich nicht einmal mehr seiner Aufmerksamkeit wert. Als ob Atreju und Sirius mit ihrem Besuch, auch viele seiner Ängste mitgenommen hätten. Bis heute.
Aber es ist vor allem die Beziehung zu seiner Frau, von der er berichtet. Er beschreibt, dass die beiden durch die Schwangerschaft, die Geburt und die Trauer danach zu stärkeren Partner*innen geworden sind, die noch enger zusammenstehen, die noch mehr auf einander Acht geben. Durch seine Frau hat Stefan das Gefühl von Empathie in einer grundlegenderen Art und Weise erlernen dürfen. Gesehen zu haben, wie sie ihre Kinder begleitet hat, mit welcher Liebe, Zuneigung und Respekt, sei eines der größten Geschenke gewesen, das er je bekommen habe. Plötzlich habe der immer lautschreiende Egoist ihn ihm, die Liebe in ihrer ganzen Größe gesehen und sei verstummt. Es wäre auch möglich gewesen, dass ihre Beziehungen an einem solchen Erlebnis zerbricht, so Stefan, das Gegenteil war aber der Fall.
Die beiden Eltern haben dabei in allen Momenten aktiv nach Hilfe gesucht und diese in Form von unfassbar liebevollen Ärzt*innen, therapeutischer Hilfe und speziellen Vereinen, wie der „Verwaiste Eltern e.V.) gefunden.
Und mit jedem Gespräch über das Erlebte wird die Angst, dass es keine Erinnerung an Atreju und Sirius gibt, kleiner. Denn jedes Gespräch über die Zwillinge ist eine neue Erinnerung, ein weiterer Beweis für ihre Existenz.
Und so komisch das klingt: Stefan ist dankbar. Nicht dafür, dass das passiert ist. Aber dafür, was sie im Schmerz und der Trauer alles entdecken durften. Geschenke, sagt er. Er beschreibt, dass er mehr denn je glaubt, dass selbst die grausamsten Dingen solche Geschenke mit sich bringen. Man müsse sie nur sehen können.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
Dein-Sternenkind:
www.dein-sternenkind.eu

Sven
Sven Bensmann ist 29 Jahre alt und dürfte den Meisten hier als Sänger & Frontmann der Band Hi! Spencer bekannt sein. Darüber hinaus kann man über Sven noch ein paar weitere Dinge sagen. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Komiker und Entertainer. Mehr als 200 Auftritte spielt er jährlich. Ob mit Band oder solo, Svens Leben ist die Bühne. Vor Menschen zu stehen und diesen eine gute Zeit zu bescheren, ist das Größte, sagt er selbst von sich.
Außerdem ist Sven ein kleines Landei und ehrlich gesagt findet er das ganz schön gut. Umso schöner findet er es allerdings, wenn er seine dörfliche Komfortzone verlässt und mit seiner Band oder eben als Comedian in die urbane Welt eintauchen kann. Denn irgendwie wusste er schon immer: „Dahinten fängt die Welt an“.
Dann ist Sven noch ein großer Fan von Jugendarbeit, insbesondere ehrenamtlicher. Mit 9 Jahren fuhr er das erste Mal mit ins Zeltlager. Mit 16 wurde er Gruppenleiter und war, bis er 25 Jahre alt war, Lagerleiter einer katholischen Jugendfreizeit, die er in seiner Hometown jährlich maßgeblich mitgestaltete. Katholisch ganz bestimmt nicht aus Überzeugung (Fun Fact: Svens kindlicher Kopf wurde nie von katholischem Weihwasser benetzt), sondern viel mehr, weil es bei Sven draußen auf dem Land keine Alternativen gab. „Das war immer irgendwie schon okay.“, kommentiert er.
Achja, Sven ist schwul. Das wars eigentlich.
So gerne dieser Text hier auch ein Ende finden könnte, weil nichts genannt wurde, was noch weiter zu besprechen wäre, so traurig ist die Tatsache, dass der Satz „Ich bin schwul“ für Sven den Großteil seines Lebens alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Mit 27 Jahren outet Sven sich in seinem privaten Umfeld. Reichlich spät, findet er selbst, war diese Sache für ihn doch schon im Teenageralter klar. Doch es ging einfach nicht anders, bekräftigt er.
Die Gründe für sein selbst bewertetes spätes Outing kann er heute klar erkennen, doch der Weg dahin dauerte über ein Jahrzehnt. „Irgendwie hab ich es geschafft mein Leben lang zu denken es wäre besser meine Sexualität, mit der ich ganz nebenbei zum Glück nie ein Problem hatte, vor meinem gesamten Umfeld zu verschließen. Heute weiß ich, dass ich mich damit in Täler begeben habe, aus denen heraus zu kommen, unfassbar viel Kraft gekostet hat.“
Denn so sehr er es auch liebt auf dem Land groß geworden zu sein, so sehr war diese Tatsache auch der Grund dafür, dass Sven sich entschloss seine „Großen Gefühle in Kartons zu verstauen und mit dem breitesten Grinsen die traurigsten Songs zu singen“ (Schalt mich ab Zitat Ende). Er hatte das Gefühl sich nie in Gänze in seinem Umfeld wiederzufinden. Um ihn herum pulsierte eine absolut heteronormative Welt. Ihm wurden Dinge als erstrebenswert gespiegelt, die er nicht erfüllen konnte und auch ganz sicher nie wollte. Frau finden, heiraten, Kinder bekommen, Haus bauen, alle 3 Jahre ein neues Auto unterm Carport stehen haben. All diese Dinge schienen seit jeher um ihn herum das non plus ultra Lebensziel gewesen zu sein. Und so sehr er auch allen gönnte diesen Traum zu verfolgen und damit glücklich zu werden, empfand Sven stets, dass es scheinbar nicht ok wäre ganz offen mit diesem ruralen Idealbild brechen zu wollen. Und das schon sehr früh.
„Irgendwas muss da mit 13/14 Jahren passiert sein, dass ich mich so vehement entschloss wirklich keiner Person dieses Planeten sagen zu wollen, dass ich schwul bin. Das ist das einzige was ich heute nicht rekonstruieren kann. Der Rest leuchtet mir komplett ein. Ich hab mir eine Rüstung aufgebaut, aus der ich später gar nicht mehr raus kommen konnte.“, so Sven selbst.
Als „Meister des Kompensierens“ bezeichnet er sich heute. So habe er sich jahrelang jedes externe Glücksgefühl ran geholt, das er kriegen konnte. „Klar, dass es einen auf die Bühne zieht, Applaus erleichtert auch die schwersten Gedanken.“, sagt er. Darüber hinaus warf er all seine Energie in Jugendarbeit. Für andere eine Jugendfreizeit zu organisieren, die nicht weniger, als das Jahreshighlight darstellt, war über einen langen Zeitraum Svens emotionaler Lebensmittelpunkt. Und dann, so sagt er selbst, hat er einfach viel gefressen. Zu Spitzenzeiten brachte Sven durch seine meist unausgewogen fettigen kompensatorischen Mahlzeiten 135 Kilo auf die Waage. Eine Erscheinung, die ihn nie störte. Der Grund für seine Essgewohnheiten war das Problem.
Mit 25 Jahren beendete Sven seine Zeit in der ehrenamtlichen Jugendarbeit. Das Loch das der Wegfall dieser Arbeit hinterlassen hatte war so groß, dass er hineinfiel und für einige Zeit dort liegen blieb. „Das war ein wirklich unschönes Jahr für mich. Quasi das Jahr in dem ich schlief, um die fantastischen Band Jupiter Jones kurz ins Spiel zu bringen. Ich wusste nicht wirklich, wie ich mich da wieder rausholen sollte. Es fehlte etwas so Großes in meinem Leben. Während viele in meinem Umfeld in ihren Beziehungen ins dritte, vierte oder fünfte Jahr gingen, trat ich auf der Stelle und hatte noch nicht mal die Möglichkeit irgendetwas in Bewegung zu setzen. Dafür müsste ich mich outen. Und das schien unmöglich, weil eben die Rüstung, die mir die Jahre über oberflächlich geholfen hatte so dick war, dass ich sie niemals leichtfüßig ablegen konnte.“
Sven ging mit sich in Gericht. Wie konnte es soweit kommen, fragte er sich oft. Immer mehr überkam ihn die Erkenntnis aus welchen Versatzstücken seiner Vergangenheit diese Situation entstanden war. Und irgendwann ging es. Im Februar 2020 nahm er all seine Kraft zusammen und outete sich unter vier Augen vor seinem besten Freund. Und nach wenigen Minuten schon beflügelte ihn das bloße Aussprechen und die Tatsache endlich voll und ganz zu sich stehen zu können so sehr, dass er die nächsten Wochen und Monate fast nichts anderes tat, als all den Menschen, die ihm wichtig waren zu sagen, dass er schwul ist. Dass er sein Leben lang Probleme damit hatte das zu sagen, eben aus Angst geliebte Menschen um ihn herum würden sich abwenden, eben weil er nicht in sein Umfeld passte und von Mal zu Mal legte er immer mehr seiner jahrelang mühsam aufgebauten Rüstung ab. „Das Schönste war eigentlich zu sehen, dass keine meiner Ängste begründet waren. Ein richtiges Streber- und Vorzeigeouting war das letztendlich. Meine Freunde und Familie freuten sich so enorm für mich. Und alle sind noch da. Ich denke ich hätte das Ganze früher machen können, aber das ging nun mal nicht und bringt die Situation auch nicht weiter. Rückblickend betrachtet kann man sagen, dass ich meinem Umfeld sicherlich mehr hätte zutrauen können, als nur das was mir gespiegelt wurde. Das möchte ich gerne als kleine Botschaft raushauen. Die Menschen, die du magst und von denen du weißt, dass sie dich auch mögen, dürfen das auch mal zeigen müssen, wenn man es gerade braucht. Am Ende ist alles gut.“
Wenig später, im Sommer 2020 begann Sven damit nicht nur emotional, sondern auch körperlich seine Rüstung verschwinden zu lassen. Durch Sport und eine deutlich ausgewogenere Ernährung nahm Sven etwa 40 Kilo ab. Nicht durch eine Diät oder eine zweiwöchige Saftkur, sondern mit dem festen Willen sich selbst anders und besser wertzuschätzen.
Am Ende steht der Song „So schön allein“. Denn jede Reise endet, Svens brachte ihn hierhin.
Hilfsangebote & weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:
VLSP*- Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie e.V.:
www.vlsp.de/coming-out
Professionelle Beratungsstellen zum Thema Sexualität und Outing in ganz Deutschland:
www.profamilia.de
Speziell für Jugendliche (Peer Beratung):
comingout.de
Unser neue Single „Hallo Jolien“ ist jetzt knapp 3 Wochen draußen - und wir feiern euer Feedback krass. ♥️ Wer von euch hat sich eigentlich im Musikvideo wiedergefunden? 🎥✨
PS. Das Video gibt’s jetzt auch auf unserem @youtube Kanal. Schaut gern mal rein. 💐
.
.
.
#hispencer #konzert #konzerte #tour #tourlife #band #show #musik #music #vorverkauf #indie #rock #punk #pop #zuendstoffbooking #unclem #unclemmusic #oben #neueplatte #neuesalbum #hallojolien

✨ bye! 2023 - hi! 2024. Schön dich zu sehen. So wie du immer schon warst. Und endlich bist du da. ✨
.
.
.
#hispencer #konzert #konzerte #tour #tourlife #band #show #musik #music #vorverkauf #indie #rock #punk #pop #zuendstoffbooking #unclem #unclemmusic #oben #neueplatte #neuesalbum #merch

Bye 2023. ✨ Und verdammt ey, merci fürs Begleiten in diesem Jahr.
An euch fürs Rauskommen auf die Konzerte. Aber auch an unserer Team, mit dem es diese Shows nicht geben könnte. Musikmachen vor Menschen ist ein krasses Privileg und ohne euch alle nicht möglich. 💐
Und wir sind ganz doll glücklich, dass da ein neues Jahr anklopft, in dem ganz viel Musik vor Menschen machen ansteht. ☁️
2024 kommt oben. Im Frühjahr gehen wir auf Tour. Vermutlich unsere größte der bisherigen 11 Jahre. Mehrere Städte sind schon ausverkauft. In den meisten anderen werden die Karten knapp. Wir wissen wirklich, wie besonders das ist. Und daher: Danke, Danke, Danke. Jedes Jahr macht es mehr Spaß, den ganzen Bums hier zu machen. Wir genießen das. ♥️
Frühjahrstour 2024: 🚐🌨️
19.04.24 Göttingen, @noergelbuff_liveclub (ausverkauft)
20.04.24 Dresden, @blauer_salon_dresden
27.04.24 Münster, @sputnikhalle_muenster (hochverlegt)
28.04.24 Bochum, @die.trompete (low tickets)
03.05.24 Meppen, @jam_meppen
04.05.24 Hamburg, Molotow (ausverkauft)
05.05.24 Bremen, @tower_hb (low tickets)
09.05.24 Frankfurt, @nachtlebenfrankfurt
10.05.24 Stuttgart, @clubcann
11.05.24 Berlin, @badehaus_berlin (low tickets)
12.05.24 Hannover, @musikzentrumhannover
17.05.24 Köln, @gebaeude9_koeln (hochverlegt)
18.05.24 Saarbrücken, @studio30live
19.05.24 München, @backstagemunich
19.12.24 Hamburg, Knust (Zusatzshow)
🎟️ Präsentiert von @zuendstoffbooking und @schall.musikmagazin - Tickets über den Link in unsere Bio. 🎟️
.
.
.
#hispencer #konzert #konzerte #tour #tourlife #band #show #musik #music #vorverkauf #indie #rock #punk #pop #zuendstoffbooking #unclem #unclemmusic #oben #neueplatte #neuesalbum #initiativemusik #vinyl #vorverkauf #bundle #merch #bandmerch #2023 @zuendstoffbooking @uncle_m_music @tobias_toto_thomas @jaspelll
📸1,2,5,8: @gemuesing
📸 4 @freddys_spaceworld
📸 3,7 @kramdelakraem

Nochmal große shoutouts an @shoreline_band und @das_bluehende_leben , die beiden phantastischen Supports unseres Doppel-JAKs im @rosenhof_osnabrueck 💐💐💐
Beide Bands gehen nächstes Jahr auf Tour - ihr solltet sie dort besuchen. 🚐 Und reinhören geht, na klar, auch immer über unsere Indiepunk Wintermusik Playlist auf @spotifyde (Link in unserer Bio) 🌱
.
.
.
📸 @gemuesing
#hispencer #konzert #konzerte #tour #tourlife #band #show #musik #music #vorverkauf #indie #rock #punk #pop #zuendstoffbooking #unclem #unclemmusic #oben #neueplatte #neuesalbum #initiativemusik #shoreline #shorelineband #münster #münsterpunkrock #dasblühendeleben #mannheim @uncle_m_music @zuendstoffbooking @boedeboedeboede @assconcerts

Sag Hallo Jolien! 👋🏼 Noch bis morgen kannst du uns ein Video schicken, um im neuen Musikvideo dabei zu sein. 🎥
Alle Infos dazu gibt es hier im Post. Freuen uns auf deine Einsendung - Es wäre schön dich zu sehen! 💐
.
.
.
@uncle_m_music @zuendstoffbooking @farbtonvideos @kramdelakraem @freddys_spaceworld #hispencer #konzert #konzerte #band #show #musik #music #vorverkauf #indie #rock #punk #pop #zuendstoffbooking #unclem #unclemmusic #oben #neueplatte #neuesalbum #neuesingle #artwork #hallojolien #musikvideo #musicvideo #hallo

Label
Uncle M Music
Mirko Gläser
Westermarktstraße 5
25840 Friedrichstadt
mirko@uncle-m.com
Design
kraem GmbH
dialog@kraem.team













